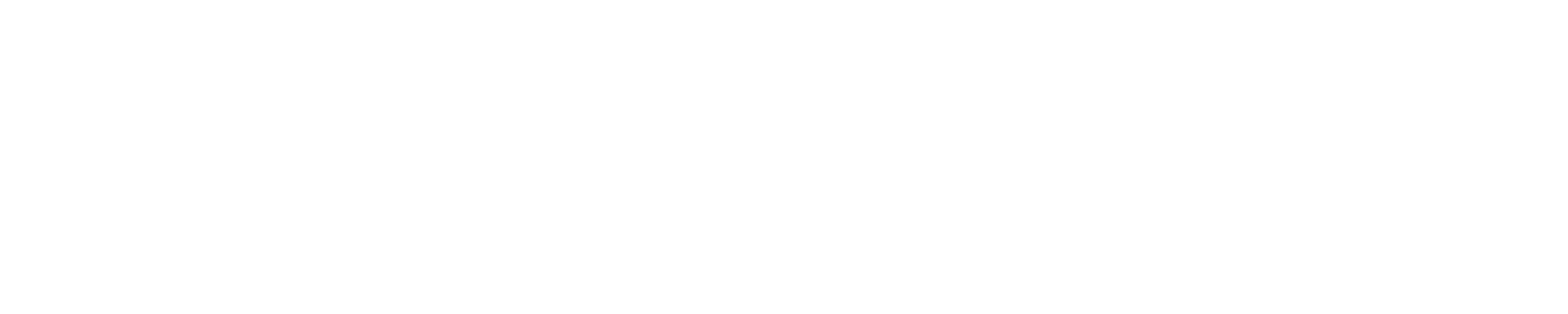Jugend-Angelwochenende an der Thülsfelder Talsperre
15.10.2025
Am Freitag, den 10.10.2025, trafen wir uns mit acht Jugendlichen U14 zum Angelwochenende beim Anglerheim des Landesverbandes Weser-Ems an der Thülsfelder Talsperre. Nachdem alle angekommen waren, bezogen wir zunächst die Zimmer. Anschließend wurde die Angelausrüstung gepackt, und wir machten uns zu Fuß auf den Weg zur Thülsfelder Talsperre.
Ein kurzer Fußmarsch, und wir waren auch schon am Wasser. Die Ruten wurden aufgebaut und ausgeworfen – und schon bald konnten die ersten Fische des Tages gefangen werden. Nach etwa dreieinhalb Stunden ging es zurück zum Anglerheim. Dort wurden die gefangenen Fische gleich verarbeitet und die Ausrüstung ordentlich verstaut.
Zum Abendessen gab es leckere Hotdogs, begleitet von ein wenig Anglerlatein, ehe dann Bettruhe angesagt war.
Der Samstag begann mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem auch Lunchpakete für den Tag vorbereitet wurden. Danach fuhren wir in den Tier- und Freizeitpark Thüle, wo wir den Vormittag verbrachten. Wir sammelten viele schöne Eindrücke und erlebten tolle Momente.
Zurück am Anglerheim wurden erneut die Ruten und das Zubehör gepackt, und wir brachen wieder zum Wasser auf. Die ersten Köder waren schnell im Wasser, doch diesmal ließen die Bisse länger auf sich warten. Nach einer gefühlten Ewigkeit konnten schließlich die ersten Fische gelandet werden. Mit fortschreitendem Nachmittag zeigte sich mehr Aktivität im Wasser, und schließlich gesellten sich auch einige größere Brassen dazu.
Mit Einbruch der Dunkelheit packten wir unsere Sachen und machten uns auf den Rückweg zum Anglerheim. Dort wurde die Angelausrüstung wieder in der Außenhütte verstaut und die gefangenen Fische verarbeitet. Zum Abendessen bestellten wir Pizza. Während wir auf das Essen warteten, wurden noch verschiedene Feeder-Montagen geknotet. Das gemeinsame Essen, begleitet von ein paar lustigen Geschichten, bildete einen gelungenen Abschluss eines erfolgreichen Angeltages.
Der Sonntagmorgen begann erneut mit einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend wurden die Koffer gepackt – das ging recht zügig, sodass wir noch etwa dreieinhalb Stunden am Wasser verbringen konnten. Einige Fische konnten auch an diesem Vormittag noch gefangen werden, was uns einen schönen Abschluss des Wochenendes bescherte.
Nachdem die Ausrüstung ein letztes Mal verstaut war, ging es zurück zum Anglerheim. Dort wurden die Zimmer gesaugt, bevor unsere Jugendlichen von ihren Eltern abgeholt wurden. Wir verabschiedeten uns herzlich – und so endete ein rundum gelungenes Wochenende.
Wir Betreuer – Torsten Kampf, Ole Pioch und Jörg Wachtmeester – bedanken uns ganz herzlich bei Lukas Karpow, Niklas Krist, Hauke Hackmann und Ben Ossevorth vom Rheder Fischereiverein sowie bei Melvin und Tyler Wolters aus Haren und nicht zu vergessen Lasse Waden und Tim Reemts aus Rhauderfehn.
Danke für die tollen Erlebnisse und das schöne Wochenende an der Thülsfelder Talsperre!
Ein besonderer Dank geht auch an Heinz Hackmann, Jugendwart aus Rhede, der uns an diesem Wochenende tatkräftig unterstützt und den Jugendlichen einige Montagen nähergebracht hat – vielen Dank dafür!
Ole Pioch
zurück